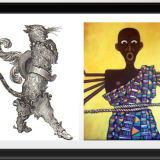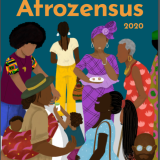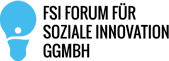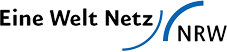Beim EMPOWERMENT DAY – Informiert in OWL am 20. Juni 2015 in Bielefeld informierte Herr Kandia Bangoura zusammen mit seiner Kollegin Ulla Rothe von La Voix des Migrants NRW (dt. Stimme der Migranten) im Workshop „Ursachen für Flucht und Migration aus Subsahara, das Recht auf Bewegungsfreiheit und der lange beschwerliche Weg nach Europa – Zeitzeugen berichten über eigene Erfahrungen“ über dieses aktuelle Thema. Herr Bangoura ist selbst aus seinem Heimatland Guinea geflüchtet. Im Folgenden Interview berichtet er über seine Erfahrungen.
- Sehr geehrter Herr Kandia Bangoura, wie würden Sie Ihr Leben bis zu dem Zeitpunkt, der als Auslöser Ihrer Migrationsentscheidung angesehen werden kann, beschreiben?
Ich war Schüler in der Hauptstadt Conakry an der Gbessia Centre-Schule und gehörte der kleinen, politisch aktiven Jugendgruppe JDED – Jeunes Démocratiques Engagés pour la Démocracy (dt. „Junge Demokraten engagiert für die Demokratie“) an, die sich 2005 gründete und die immer sonntags freiwillige Saubermachaktionen in unserem Viertel durchführte, um die Lebensqualität vor Ort zu erhöhen. Diese Aktionen dienten aber auch dazu, neue Anhänger zu gewinnen, wobei wir nur Jugendliche und junge Erwachsene aufnahmen. Nach diesen sonntäglichen Aktionen versammelten wir uns immer von 17-21 Uhr, um über Politik und Soziales zu sprechen.
- Was bewog Sie konkret, Ihr Heimatland Guinea zu verlassen?
Nach dem Tod des Diktators Condé 2009 übernahm Dadis Camara nach einem Militärputsch die Macht. Zunächst versprach er, den Weg für Wahlen frei zu machen. Als er sich nach einem halben Jahr selbst aufstellen wollte, stieß das nicht nur in den Reihen von JDED auf Unverständnis. Am 27. September 2009 versuchte JDED daher im Viertel einen Protestmarsch zum „Stadion des 28. Septembers“ zu organisieren. 137 Personen waren schon für den Plan gewonnen, als das Militär kam, um ihnen die Durchführung des geplanten Marsches zu verbieten. Zwar löste sich die Menge zunächst auf, aber dennoch konnte man sich darauf einigen, sich am nächsten Morgen zu treffen, um den geplanten Marsch durchzuführen.
Am 28. September kamen Demonstranten aus vielen Vierteln der Stadt am Madiné, dem größten Markt von Conakry zusammen – unter ihnen auch Vertreter offizieller politischer Parteien. Zusammen ging es weiter in Richtung Stadion. 200 Meter davor wurden sie durch eine Wegsperre des Militärs gestoppt. Der Versuch, verantwortliche Rädelsführer auszumachen und die Menge aufzulösen, scheitere unter anderem an der zahlenmäßigen Unterlegenheit des Militärs, das auch mit Steinen beworfen wurde. Auch Warnschüsse in die Luft änderten daran nichts. Die Menge enterte planmäßig das Stadion und begann mit ihrer Kundgebung. Es dauerte nicht lange und das Militär kam mit Verstärkung zurück. Nun wurde wahllos in die Menge geschossen, auch kamen andere Waffen wie Messer zum Einsatz. Ich floh und versuchte mich über einen Zaun zu retten als mich ein junger Soldat mit einer Gewehrkugel am rechten Fußgelenk traf. Ich fiel runter und bekam unter Beschimpfungen wie „Hurensohn“ und „ihr seid die Opfer für die Nation“ das Gewehrende ins linke Auge gestoßen, woraufhin ich das Bewusstsein verlor.
Als ich erwachte, lag ich auf einem Bett in einer Halle des Hospitals, neben mir meine Mutter und ein Arzt, den sie schon seit der Schule kannte. In der Halle befanden sich Verletzte wie Tote gleichermaßen – viele auf dem Boden, da nicht genug Betten da waren. Der Arzt gab uns deutlich zu verstehen, dass wir hier nicht sicher seien, da man alles vertuschen wolle und es daher ein Frage der Zeit sei, wann das Militär auftaucht. Um ca. 22 Uhr wurde das Hospital tatsächlich gestürmt. Die Soldaten schickten das Personal bis auf zwei Ausnahmen nach Hause, ließen sich die Schlüssel geben und schlossen alle Türen ab. Ich hatte Glück: Der erwähnte Arzt, der über Schlüssel verfügte, schmuggelte mich unter Gefährdung seines Lebens über den Hinterausgang aus dem Gebäude, wo schon ein Taxi, in dem meine Schwester saß, wartete. Die Sache zog sich hin, da ich nicht laufen konnte und ich über einen Rollstuhl ins Auto musste, aber letztlich klappte die Flucht.
- Bitte schildern Sie grob Ihre Fluchtroute bis nach Deutschland. Welche „Stationen“ blieben Ihnen besonders im Gedächtnis und warum?
Mit meiner Schwester ging es nach Bamako, der Hauptstadt Malis, wo ich einen Monat mit Medikamenten etc. in einem Privathaus behandelt wurde und nicht ein einziges Mal vor die Tür ging. Ein junger Malier teilte das Zimmer mit mir.
Mit Krücken und einer Augenbinde verließ ich mit ihm Mali und fuhr mit dem Bus nach Niamey (Niger), nachdem mir meine Schwester das Ticket besorgt hatte. Ein Mann und eine Frau, die angeblich die ältere Schwester des Maliers gewesen sein sollte, holten uns am Busbahnhof ab. Der junge Malier verließ uns nach einer Woche, wir blieben aber in Kontakt. Als es mir wieder etwas besser ging und ich wieder zurück nach Guinea wollte, riet man mir aufgrund der weiterhin für mich dort bestehenden Gefahr davon ab und empfahl mir stattdessen, dass ich Richtung Algerien aufbrechen sollte. Nachdem „la vieille“ [dt. „die Alte“, also die Schwester des Maliers; Anm. des Interviewers] über ihren Bruder Geld von meiner Familie erhalten hatte, ging es mit einem Kanister Wasser, einem Brot- und Ölsardinendosenvorrat sowie 20000 CFA (rd. 30 Euro) in einem mit ca. 70 Personen beladenen LKW in Richtung Norden. In Algerien angekommen – so die „Alte“ – würde sie mir den Kontakt ihres dort lebenden Bruders geben.
Aber am zweiten Tag hatte der LKW bereits inmitten der Wüste eine Panne. Abends wurden wir von bewaffneten Nomaden [O-Ton / dt. „in schwarz gehüllte Touareg“; Anm. Interviewer] ausgeraubt. Zudem entführten sie die zehn jüngsten der insgesamt 25 Frauen, die dabei waren.
Nun bildeten sich Grüppchen –größtenteils in franko- bzw. anglophon unterteilt – und irrten in der Wüste umher. Meine Gruppe setzte sich mit mir aus zwei Guineern, vier Senegalesen und einer Nigerianerin zusammen. Nach einem guten Tag konnten die beiden Senegalesen nicht mehr und blieben erschöpft zurück. Nicht sehr viel später kamen „Araber“ mit kleinen Autos vorbei und nahmen uns mit. Zwar gaben sie uns zu essen und zu trinken, die beiden zurückgebliebenen Senegalesen wollten sie jedoch nicht mehr suchen. In Agadez (Niger) ließen sie uns raus. Moscheebesucher, die das Gebäude gerade verließen, brachten uns ins ein Viertel, wo sich viele Flüchtlinge aus Subsahara aufhielten. Auch dort musste ich feststellen, dass es für die beiden zurückgebliebenen Senegalesen keine zu erwartende Hilfe mehr gab [O-Ton: „ça c´est fini“, dt. „es ist vorbei“].
Schnell bekam ich mit, dass es scheinbar keine gute Idee war, nach Algerien zu wollen, da es da für einen Ausländer besonders schwer sei. Libyen sei da schon besser. Wir kamen in einem verlassenen Rohbau ohne fertige Türen und Fenster für eine Monatsmiete von umgerechnet 250 Euro unter. Hier herrschte fliegender Wechsel: Während einige tagsüber arbeiteten und nachts schliefen, war dies bei anderen umgekehrt. Das Geld dafür zusammenzukriegen, war nicht einfach; mit Gelegenheitsarbeiten auf dem Bau sowie mit Trägerdiensten verdienten wir maximal bis zu vier Euro pro Tag, wobei es vorkommen konnte, dass man pro Woche nur einmal arbeiten konnte. An einer Brücke warteten wir täglich darauf, dass uns jemand einsetzen konnte. Mit dem Geld musste neben der Miete die Verpflegung bezahlt und für das Weiterkommen gespart werden.
Nach drei Monaten – im September 2009 – brach ich in einem überfüllten LKW Richtung Libyen auf. Um die Sicherheit auf dem Weg „gewährleisten“ zu können, wurde das Militär schon vorab geschmiert. Eskortiert von zwei Militärfahrzeugen begann die Fahrt. Schon nach einer kurzen Zeit drehten diese jedoch schon wieder um. Nachts wurden wir von bewaffneten Touareg angerhalten und ausgeraubt. Der Fahrer des LKWs steckte mit denen unter einer Decke. Während er zurückfuhr, zeigten sie uns eine Karte der Gegend, sagten uns, dass wir in etwa zwei Tagen Libyen erreichen würden und verboten uns, jemals wieder zurückzukommen. In Grüppchen, die alle Sichtkontakt zueinander hatten, liefen wir durch die Wüste bis drei libysche Militärfahrzeuge kamen, uns mitnahmen und zwei Monate ins Gefängnis stecken. Dort behandelte man uns unmenschlich. Die Verpflegung war mangelhaft, die sanitäre Situation untragbar – die Toiletten befanden sich mitten in den überfüllten Zellen – die Wärter fassten uns nur mit Gummihandschuhen an und fast täglich wurden die etwa 200 Insassen in die umliegende Wüste gebracht und bis zum Abend der sengenden Sonne ausgesetzt. Nach zwei Monaten gelang es allen Insassen, über die instabil konstruierte Decke, die wir aufbrechen konnten, nachts zu fliehen. Dem hatten die Wärter zunächst nichts entgegen zu setzen.
Wir flohen in einen Wald, wo wir die Nacht blieben. Am nächsten Tag trafen wir einen Bauern. Dieser konnte mit einem Senegalesen in unserer Gruppe arabisch sprechen. So erfuhren wir, dass im nächsten Ort schon die Polizei nach uns suchen würde. Er riet uns, diesen Ort zu umgehen. Als wir ihm schilderten, was wir im Gefängnis durchmachen mussten, schien er geschockt zu sein. Dann sagte er, dass er mit zwölf Schwarzen zusammenarbeite, die morgen wieder da seien und die uns vielleicht auf unserem weiteren Weg helfen könnten. Nachdem wir eine Nacht auf dem Gehöft des Bauers verbracht hatten, kamen sie und da wir kein Geld hatten, wurde letztlich folgende Abmachung getroffen: Wir sollten nach Tripolis gebracht werden, wo sie Freunde hätten. Dort angekommen, müssten wir aber die Fahrtkosten binnen einer Woche zurückzahlen. Sie hinterlegten das von ihnen vorgestreckte Geld beim Bauern, der es gut mit uns zu meinen schien; erst wenn wir tatsächlich in Tripolis angekommen seien – so die Abmachung – solle der Fahrer das Geld kriegen. Diesen rief der Fahrer auch an, als wir dort angekommen waren. Wir trafen Freunde der erwähnten Männer in einem Bahnhof. Am nächsten Tag begaben sich die meisten schon direkt auf Arbeitssuche, während drei weitere und ich krankheitsbedingt erst nach drei Tagen damit beginnen konnten.
Die Arbeitssituation in Libyen war sehr gut, bei einem türkischen Bauunternehmen fand ich Arbeit, das Geld konnte ich zurückzahlen. Bis zum Beginn des Kriegs im Frühjahr 2011 arbeitete ich für dieses Bauunternehmen. Zum Ausbruch des Kriegs befand ich mich gerade in Bengasi. Viele wollten in ihre Heimatländer zurück, was für mich aufgrund der Bedrohung dort unmöglich war. In Bengasi war die Situation lebensgefährlich für mich, da die Rebellen Schwarze für Söldner Gaddafis hielten. Durch libysches Militär flankiert brachten die Türken sich, ihre afrikanischen Arbeiter und ihre Maschinen in einem aus ca. 25 Bussen und LKW bestehenden Konvoi nach Tripolis in Sicherheit.
Den Chef, der meine persönliche Geschichte kannte, bat ich, mich mit in die Türkei mitzunehmen. Dieser entgegnete mir, dass er es organisieren könne, mich nach Tunesien zu bringen, was ich ablehnte. Ich bot ihm mein ganzes Geld – etwa 3000 Dollar – an. Nach einer Weile meldete er sich und sagte, dass er einverstanden sei, aber das Geld sofort wolle. Nach einem Hin und Her tat ich dies auch, auch wenn ich ihm misstraute. Nachts darauf holte er mich ab und versteckte mich in einer Baumaschine, die auf ein Schiff in Richtung Türkei verladen wurden. Dort steckte man mich in einen Schrank in der Küche, der abgeschlossen wurde. Ich wurde verpflegt, verließ den Schrank jedoch die gesamte Überfahrt nicht, weshalb ich auch nicht schätzen kann, wie lange diese dauerte. Mit dem Hinweis, dass ich niemanden kennen zu haben, wenn die Polizei Fragen stellt, überließ man mich mir selbst.
Die Polizei nahm mich in Handschellen mit auf eine Polizeistation, wo ein Beamter französisch sprach. Meinen Beteuerungen, dass ich mich ohne jegliche Hilfe auf das Schiff geschmuggelt habe, schenkte man keinen Glauben. Als man mir drohte, mich wieder nach Libyen zurückzubringen, gab ich zwar die Hilfe durch Dritte zu. Als man mir aber Fotos zeigte, auf denen der Mann aus der Schiffsküche zu sehen war, verriet ich diesen nicht. Nach drei Tagen Gefängnis kamen zwei Frauen vom UNHCR mit Formularen, in denen ich meine Fluchtgründe darlegen sollte. Nachdem ein Arzt mein verletztes Auge sowie die Schusswunde im Fuß kontrolliert hatte, stellte man mir ein für sechs Monate gültiges Papier mit meinem Foto darauf aus und gab mir ein Zimmer.
Die Afrikaner vor Ort , mit denen ich schnell in Kontakt kam, warnten mich, dass die Gefahr bestünde, dass meine Papiere nach Ablauf der sechs Monate nicht verlängert werden könnten und es daher besser sei, vorher in Richtung Griechenland aufzubrechen, bevor man mich abschiebe. Über einen seit 22 Jahren in Istanbul lebenden Landsmann fand ich Arbeit in der Schuhproduktion, wo ich vier Monate arbeitete. Nachdem ich ihm 300 Dollar bezahlt hatte, holte man mich spät abends ab. An einem Wald hielten wir. Zu Fuß ging es ca. zehn Kilometer bis zum Meer. Dort wartete ein Schlauchboot. Mit 37 Personen an Bord stachen wir unter Führung von zwei Algeriern in See. In Sichtweite zur griechischen Küste bekam unser Schlauchboot ein Loch, nachdem es einen Felsen streifte, und sank. Bis die griechische Küstenwache kam, starben sieben Menschen – darunter zwei Kleinkinder. An Land wurden wir in ein Lager gebracht, Fingerabdrücke genommen und ein 6-Monate-Papier ausgestellt. Mit dem Hinweis, dass wir den Ort nun verlassen müssten, versuchten wir nach Athen zu gelangen. Aufgrund von Geldmangel kamen wir mit dem Bus nicht weit. In einem Ort kauften ein Gabuner und ich mit dem letzten Geld Wasser und einige Nahrungsmittel, bevor wir den restlichen Weg zu Fuß in Angriff nahmen. Nach zwei Tagen stiegen wir ohne Ticket in einen Bus. In Athen angekommen, wurden wir kontrolliert. Für das Fahren ohne Ticket wurde eine Strafe von 100 Euro erhoben, bei Nichtzahlen würde man unser 6-Monate-Papier nicht verlängern, hieß es.
In Athen kam eine harte Zeit auf mich zu. Sieben Monate lebte ich auf der Straße. In einer kirchlichen Einrichtung konnte man sich immerhin jeden Morgen waschen und bekam ein kleines Frühstück. Auch konnte man seine Kleidung waschen. Den restlichen Tag durchsuchte ich – ausgestattet mit einem Einkaufswagen – den Müll zum einen nach Lebensmitteln und zum anderen nach Altpapier. Letzteres brachte mir an Spitzetagen sieben Euro ein, wovon ich nach Möglichkeit immer etwas auf die Seite legte und sparte. Nach vier Monaten ging ich zur Polizei, um ihr meine Situation zu erklären. Dort traf ich eine Anwältin, die von einer antirassistischen Vereinigung kam. Sie versprach mir zu helfen. Tatsächlich zahlten sie die Strafe von 100 Euro für mich. Nach sieben Monaten auf der Straße ging ich in ein Dorf, wo Afrikaner bei der Olivenernte helfen konnten. Dort arbeitete ich drei Wochen täglich von 8-10 Uhr und verdiente pro Tag 10 Euro. Mit dem Ersparten machte ich mich zusammen mit zwei weiteren mit dem Zug nach Thessaloniki auf, von dort ging es in Richtung Grenze zu Mazedonien, die wir in der Nacht überquerten. Nun waren wir sechs Stunden zu Fuß unterwegs, den Rest fuhren wir mit einem Taxi an einen Bahnhof in der Hauptstadt Skopje, wo die Polizei schon auf uns zu warten schien. Wir wurden in ein Gefängnis gebracht, in dem wir unsere Verpflegung selbst zahlen mussten. Schon nach wenigen Tagen gab uns die Polizei zu verstehen, dass sie uns an die serbische Grenze bringen würde und sie uns – sollten wir wieder zurückkommen – wieder nach Griechenland abschieben würde. An der Grenze angekommen erblickte ich etliche Flüchtlinge aus aller Welt. Mit zwei Pakistanern verhandelte ich über den Preis, um nach Serbien gebracht zu werden. Da ich diesen zwei Männern fünf weitere vermitteln konnte, musste ich anstatt der üblichen 3-400 Euro nur 100 Euro bezahlen. Ein erster Versuch des Grenzübertritts scheiterte. Der zweite Versuch klappte. Nach zwei Tagen Fußmarsch in Richtung Belgrad kam ein Auto mit einem Pakistaner am Steuer und stopfte dieses mit ca. 20 Personen voll und fuhr in Richtung Subotica. Dort ließ man uns am Rande eines Flüchtlingscamps raus. Allerdings ließ man uns entgegen der Aussagen der Pakistaner nicht rein. Zwei Tage schliefen wir daher die Nächte im Freien. Dann kamen fünf Taxen und fragten, wer nach Ungarn weiterwolle. Zusammen mit vier weiteren fuhren wir in einem Taxi für je 50 Euro an die ungarische Grenze. Nachdem wir die Grenze überschritten hatten und etwa drei Stunden unterwegs gewesen waren, fasste uns die Polizei und fesselte uns mit Tape-Band. In einem voll beladenen Bus brachte sie uns in ein Camp, nahm unsere Fingerabdrücke und steckte je zehn Personen in einen Raum. Dort blieb ich drei Monate, in denen ich gesundheitlich aufgrund der mangelhaften Versorgungslage abbaute. Für die Verpflegung mussten wir abgesehen von einem Frühstück genauso selbst aufkommen wie für unseren medizinischen Bedarf – abgesehen von Paracetamol. Jeden Tag flohen Menschen in Richtung Westen. Als ich Freigang hatte und zusammen mit zwei weiteren die ca. 35 km vom Camp entfernte Stadt besuchte, um einzukaufen, flohen wir via Mitfahrgelegenheit. Während die zwei anderen nach Frankreich gingen, blieb ich in München. Ein Taxifahrer brachte mich zu einer Polizeistation. Dort nahm man Fingerabdrücke. Am Folgetag brachte man mich in eine Flüchtlingseinrichtung in Dortmund. Nach zwei Wochen in eine weitere bis ich letztlich nach Delbrück kam, wo ich nun seit zwei Jahren bin und mir ein Zimmer mit drei Mitbewohnern teile. Bis heute darf ich keine Deutschkurse besuchen. Aber eigeninitiativ habe ich den Kontakt zu den Delbrückern aufgenommen, wo ich bis zu vier Mal pro Woche im Fußballverein mit der Bevölkerung in Kontakt komme und auch meine Deutschkenntnisse voranbringen kann. Zudem schloss ich mich dem Netzwerk Afrique-Europe Interact sowie La Voix des Migrants NRW (dt. Stimme der Migranten) an. Dort lernte ich auch Ulla Rothe kennen, mit der ich am 20. Juni den Workshop zum Thema Flucht und Migration beim EMPOWERMENT DAY in Bielefeld anbieten werde.
- Wo sehen Sie sich in fünf Jahren?
Ich denke, dass ich meine Freiheit wiedergefunden habe werde, die ich schon seit sieben Jahren suche – vielleicht hier. Danach kann man alles machen.
Sehr geehrter Herr Bangoura, besten Dank für das Interview.
Einen weiteren persönlichen Erfahrungsbericht finden Sie hier. Viele weitere Beiträge zum Thema finden sich ebenfalls im Magazin von Afrika-NRW.net